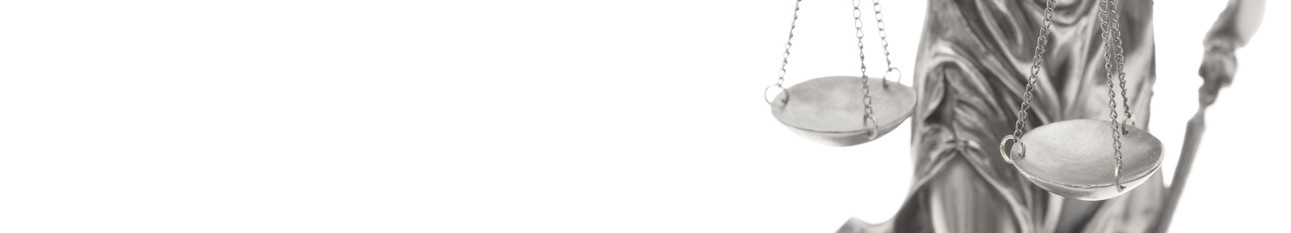Arbeitsgerichtsprozess
von Parwin Schausten – Fachanwältin für Arbeitsrecht
Inhalt:
Aufbau der Arbeitsgerichtsbarkeit
Ablauf des arbeitsgerichtlichen Verfahrens
Vertretung im arbeitsgerichtlichen Verfahren
Rechtsanwaltskosten
Aufbau der Arbeitsgerichtsbarkeit
Die Arbeitsgerichtsbarkeit ist dreistufig aufgebaut:
Eingangsinstanz ist stets das Arbeitsgericht. Hier wird die Klage erhoben. Jede Kammer der Arbeitsgerichte ist mit einem Berufsrichter (Vorsitzender der Kammer) und je einem ehrenamtlichen Richter aus dem Kreis der Arbeitnehmer und dem Kreis der Arbeitgeber besetzt (§ 16 Abs.2 ArbGG).
Die zweite Instanz ist das Landesarbeitsgericht (LAG). Hier findet im Berufungsverfahren oder im Beschwerdeverfahren die Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidungen des Arbeitsgerichtes statt. Die Kammern der Landesarbeitsgerichte sind in gleicher Weise wie die der Arbeitsgerichte besetzt (§ 35 II ArbGG).
Gegen die Urteile der Landesarbeitsgerichte findet die Revision zum Bundesarbeitsgericht (BAG) statt, sofern sie in dem Urteil des Landesarbeitsgerichts oder in einem Beschluss des Bundesarbeitsgerichts zugelassen worden ist (§§ 72 ff. ArbGG). Die Senate beim Bundesarbeitsgericht sind drei Berufsrichtern (ein Vorsitzender Richter und zwei beisitzende Richter) und je einem ehrenamtlichen Richter aus dem Kreis der Arbeitnehmer und dem Kreis der Arbeitgeber besetzt.
 Ablauf des arbeitsgerichtlichen Verfahrens
Ablauf des arbeitsgerichtlichen Verfahrens
Der Arbeitsgerichtsprozess wird durch wirksame Klageerhebung in Gang gesetzt. Die Klage muss schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle des zuständigen Arbeitsgerichts eingereicht werden.
Nach Einreichung der Klage beim Arbeitsgericht wird eine Güteverhandlung seitens des Gerichts anberaumt. In Kündigungsverfahren hat der Gesetzgeber wegen der Dringlichkeit bestimmt, dass die Güteverhandlung innerhalb von zwei Wochen nach Einreichung der Klage stattfinden soll (§ 61a Abs.2 ArbGG). Eine so kurzfristige Terminierung ist in der Praxis jedoch nicht üblich.
Die Parteien erhalten eine Ladung zu diesem Gütetermin. Sofern die Parteien allerdings durch Rechtsanwälte vertreten sind, erhalten sie eine persönliche Ladung nur dann, wenn das Gericht ihr persönliches Erscheinen ausdrücklich anordnet.
Erfolgt die Anordnung des persönlichen Erscheinens der Partei kann der Termin durch den Rechtsanwalt nur unter folgenden Voraussetzungen allein wahrgenommen werden: Der Rechtsanwalt muss zur Aufklärung des Tatbestandes in der Lage ist, den Sachverhalt also kennen. Er muss ferner von der Partei bevollmächtigt sein, die gebotenen Erklärungen abzugeben, insbesondere einen Vergleich abzuschließen (§§ 51 ArbGG, 141 Abs.2,3 ZPO). Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, erfolgt keine Entbindung der Partei von ihrer Pflicht zum persönlichen Erscheinen durch das Gericht. Die Zulassung des Rechtsanwalts kann seitens des Gerichts abgelehnt werden und gegen die nicht erschienene Partei ein Ordnungsgeld verhängt werden.
Ziel der Güteverhandlung ist es, eine gütliche Einigung zwischen den Parteien zu erzielen. Die Güteverhandlung findet nicht vor der Kammer, sondern vor dem Vorsitzenden Richter der Kammer allein statt. Der Vorsitzende erörtert gemeinsam mit den Parteien unter freier Würdigung aller Umstände die Sach- und Rechtslage. Dabei kann der Vorsitzende schon alle Handlungen mit Ausnahme der eidlichen Vernehmung zur Sachverhaltsaufklärung vornehmen, die sofort erfolgen können, z.B. Einsicht in Arbeitsverträge und andere Urkunden, Anhörung der Parteien, Vernehmung präsenter Zeugen (§ 54 Abs.1 ArbGG). Mit Zustimmung der Parteien kann ein zweiter Gütetermin anberaumt werden.
Ist eine Einigung möglich, wird deren Inhalt in einem gerichtlichen Vergleich festgehalten, der protokolliert wird. Es besteht die Möglichkeit einen Vergleich unter dem Vorbehalts des Widerrufs zu schließen; d.h. die Parteien können innerhalb einer Widerrufsfrist, deren Dauer in der Güteverhandlung vereinbart wird (in der Regel 2 bis 3 Wochen), durch schriftliche Widerrufserklärung an das Gericht wieder Abstand von dem Vergleich nehmen. So besteht nochmals die Möglichkeit, gegebenenfalls gemeinsam mit dem Rechtsanwalt zu überlegen und zu besprechen, ob der Vergleich mit seinen Folgen bestandskräftig werden soll.
Ist eine gütliche Einigung nicht möglich, scheitert die Güteverhandlung. Es wird dann Termin zur streitigen Verhandlung des Sache vor der Kammer des Arbeitsgerichts festgesetzt (§ 54 Abs.4 ArbGG). Auch in der Kammerverhandlung wird in der Regel nochmals auf eine gütliche Einigung durch den Vorsitzenden hingewirkt, da in jeder Lage des Verfahrens eine gütliche Erledigung angestrebt werden soll. Scheitert diese auch hier, entscheidet das Arbeitsgericht nach Abschluss der Kammerverhandlung über die Klage durch ein Urteil.
Der Arbeitsgerichtsprozess ist grundsätzlich öffentlich. Die Öffentlichkeit kann in besonderen gesetzlich näher bestimmten Gründen (§ 52 ArbGG) ausgeschlossen werden.
Anwaltliche Vertretung im arbeitsgerichtlichen Verfahren
Im erstinstanzlichen Verfahren vor den Arbeitsgerichten besteht kein Anwaltszwang. Die Parteien können sich dort vielmehr selbst vertreten oder durch eine andere Person vertreten lassen (§ 11 Abs.1 S. 1 ArbGG). Anwaltszwang hingegen besteht vor den Landesarbeitsgerichten oder dem Bundesarbeitsgericht. Hier müssen die Parteien sich durch Rechtsanwälte als Prozessbevollmächtigte vertreten lassen; zur Vertretung berechtigt ist jeder bei einem deutschen Gericht zugelassene Rechtsanwalt.
Rechtsanwaltskosten
„Wer verliert, der trägt die Kosten“ – dieser Grundsatz gilt im arbeitsrechtlichen Bereich nicht uneingeschränkt. Im Urteilsverfahren erster Instanz besteht kein Anspruch gegen den Prozessgegner auf Erstattung der Rechtsanwaltskosten (§ 12a ArbGG); dies gilt auch für die Rechtsanwaltskosten, die vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens entstehen. Hier trägt jede Partei ihre Rechtsanwaltskosten selbst.
In der zweiten Instanz und im Revisionsverfahren gilt allerdings wiederum die allgemeine Regelung, dass die Partei, die den Rechtsstreit verliert, die Kosten des Verfahrens zu tragen hat.
Auf Antrag kann einer Partei Prozesskostenhilfe bewilligt werden. Voraussetzung ist, dass eine Partei nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, und die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint (§ 114 ZPO).
Ebenfalls auf Antrag kann einer Partei, die außerstande ist, ohne Beeinträchtigung des für sie und ihre Familie notwendigen Unterhalts die Kosten des Prozesses zu bestreiten, und die nicht durch ein Mitglied oder einen Angestellten einer Gewerkschaft oder einer Vereinigung von Arbeitgebern vertreten werden kann, ein Rechtsanwalt beigeordnet werden, wenn die Gegenpartei durch einen Rechtsanwalt vertreten ist. Sind die Voraussetzungen erfüllt, hat das Arbeitsgericht auf das Recht zur Beantragung einer Beiordnung hinzuweisen. (§ 11a ArbGG).
Hier finden Sie mehr Informationen zur Kündigungsschutzklage